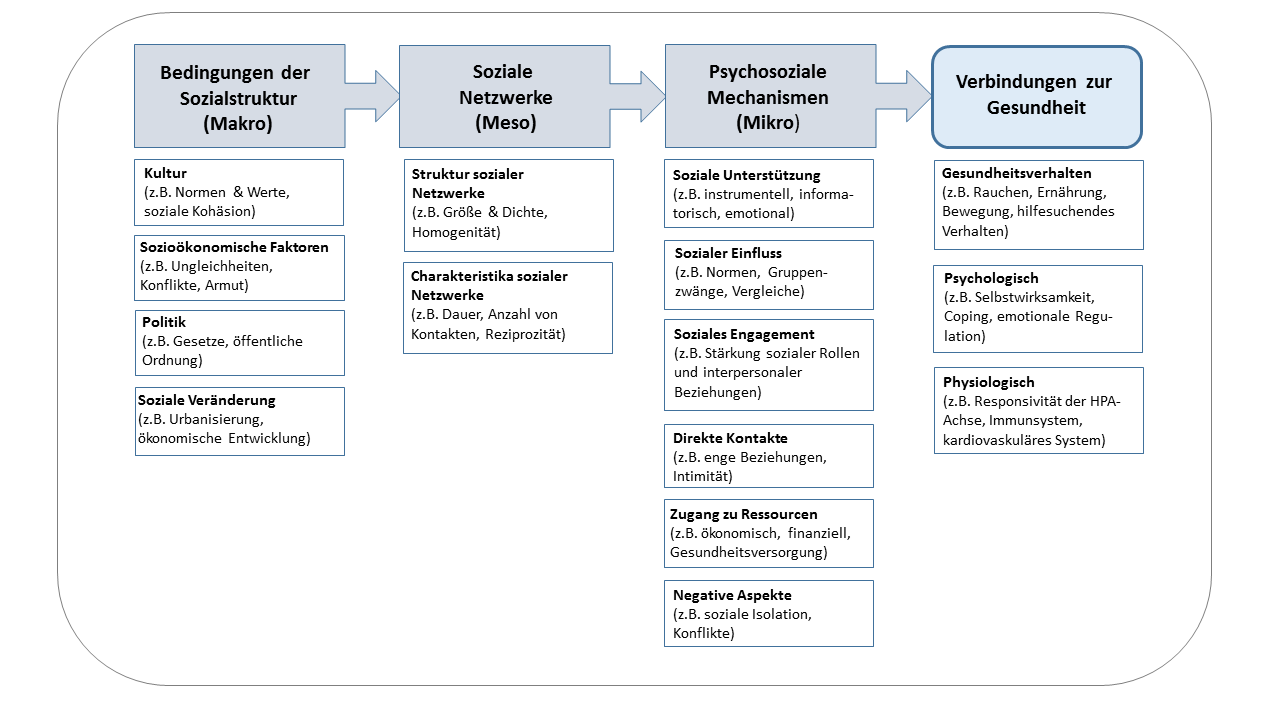Soziale Unterstützung
Nico Vonneilich , Peter Franzkowiak
Zitierhinweis: Vonneilich, N. & Franzkowiak, P. (2022). Soziale Unterstützung. In: Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) (Hrsg.). Leitbegriffe der Gesundheitsförderung und Prävention. Glossar zu Konzepten, Strategien und Methoden.
Zusammenfassung
Soziale Unterstützung kann als qualitative Eigenschaft sozialer Beziehungen verstanden werden und in unterschiedlichen Formen, beispielsweise instrumentell oder emotional, erbracht werden. Für die Zusammenhänge zwischen sozialer Unterstützung und Gesundheit spielt neben der tatsächlichen Unterstützung eine Rolle, inwiefern diese Unterstützungsleistungen als adäquat wahrgenommen werden. Um die Zusammenhänge zwischen sozialer Unterstützung und Gesundheit zu erklären, kommen zwei grundlegende Ansätze in Frage. Entweder wirkt soziale Unterstützung generell positiv auf Gesundheit (Haupteffekt-Modell), oder sie wirkt insbesondere in Zeiten von Krisen und Stress protektiv (Puffer-Modell). In der bisherigen Forschung konnten für beide Wirkmechanismen Hinweise gefunden werden. Für die medizinische und präventive Praxis verweist soziale Unterstützung auf das soziale Umfeld in Gemeinden, Stadtteilen und Quartieren, in denen soziale Integration gefördert und gelebt werden kann.
Schlagworte
Soziale Unterstützung, soziale Integration, soziale Isolation, soziale Netzwerke, Gesundheit
Was ist soziale Unterstützung?
Soziale Unterstützung ist eine qualitative Eigenschaft von sozialen Beziehungen. Ohne soziale Kontakte, ohne eine Einbettung in Soziale Netzwerke und Netzwerkförderung (siehe dazu auch Soziales Kapital) findet keine soziale Unterstützung statt. Sind Anzahl und Frequenz sozialer Kontakte Maße für die Quantität sozialer Beziehungen, dann ist soziale Unterstützung ein Maß für die Qualität dieser Beziehungen. Dabei kann zwischen objektiven und subjektiven Aspekten von Unterstützung unterschieden werden (Turner & Marino 1994).
Es konnte gezeigt werden, dass nicht nur die tatsächlich erhaltene Unterstützung und damit objektiv messbare Unterstützung relevant ist, sondern die subjektiv wahrgenommene Unterstützungsbereitschaft eine zentrale Rolle spielt. Bereits das Gefühl, im Ernstfall über soziale Unterstützung zu verfügen, kann beispielsweise negative Auswirkungen von akutem Stress abmildern, ohne dass tatsächlich Unterstützung in Anspruch genommen wird (House et al. 1988; Turner & Marino 1994; Uchino 2009).
Zudem wurden zwischen tatsächlich erhaltener und subjektiv wahrgenommener Unterstützung nur geringe Zusammenhänge gefunden, was darauf hindeutet, dass diese als jeweils relativ eigenständige Konstrukte angesehen werden können (Barrera 1986; Lakey & Cohen 2000). Soziale Unterstützung kann dabei in unterschiedlichen Formen stattfinden und wahrgenommen werden, da sie sowohl emotionale und instrumentelle als informationelle Unterstützung beinhalten kann (siehe Tabelle 1).
Emotionale Unterstützung bezieht sich auf diejenigen sozialen Kontakte, die für Gespräche über eigene Gefühle und Empfindungen zur Verfügung stehen, die zur Diskussion alltäglicher Ängste und Sorgen beitragen oder auch Bestätigung für Sympathie und Zuneigung bieten können. Instrumentelle Unterstützung umfasst diejenigen Unterstützungsformen, die sich durch praktische Hilfe – beispielsweise im Haushalt, mit der Kinderbetreuung oder durch das Leihen von Geld oder anderen Waren – auszeichnen. Unter informationeller Unterstützung werden all jene Leistungen verstanden, die Wissen zum Lösen bestimmter Probleme, oder Wissen über den Zugang zu bestimmten Ressourcen beispielsweise innerhalb einer Gemeinde, verfügbar machen. In Tabelle 1 findet sich eine kurze Darstellung unterschiedlicher Aspekte sozialer Unterstützung, basierend auf Wills & Shinar (2000).
Unterschiedliche Funktionen von sozialer Unterstützung | Beispiele | Möglicher Nutzen |
Emotionale Unterstützung | Diskussion von Gefühlen, Gespräche über Sorgen und Ängste, Bestätigung von Sympathie und Zuneigung, Akzeptieren einer Person. | Verringerung von wahrgenommener Bedrohlichkeit kritischer Lebensereignisse, Verstärkung von Selbstbewusstsein, Verbesserung von Bewältigungsstrategien. |
Instrumentelle Unterstützung | Verfügbarkeit von Geld, Haushaltsgütern, Werkzeug, Transport, Hilfe in der Kinderbetreuung, Unterstützung im Haushalt. | Trägt zur Lösung praktischer Probleme bei, erlaubt mehr Zeit für Erholung, unterstützt weitere Bewältigungsstrategien. |
Informationelle Unterstützung | Information über Ressourcen, Vorschlag von alternativen und effektiveren Handlungsstrategien. | Steigert den Anteil verfügbarer nützlicher Informationen, trägt zur Erreichbarkeit erforderlicher Unterstützung bei, führt zu effektiverer Bewältigung. |
Freundschaftliche Unterstützung | Partner für gemeinsame Aktivitäten (Sport, Theater, Kino, Partys, Reisen etc.). | Positiver Affekt, Entlastung und Erholung von Pflichten und Anforderungen, positive Ablenkung. |
Bestätigung (Feedback, soziale Vergleiche) | Bietet Orientierung an Normen und Werten, Feedback zum individuellen Status im Vergleich zur jeweiligen Population. | Verringert subjektive Wahrnehmung eigener Abweichung, steigert Akzeptanz eigener Einstellungen und Gefühle, bietet die Möglichkeit vorteilhafter Vergleiche (Selbstwert). |
Tab. 1: Unterschiedliche Funktionen von sozialer Unterstützung (nach Wills & Shinar 2000)
Soziale Unterstützung bietet die Möglichkeit positiver sozialer Kontakte und darüber ein Gefühl der sozialen Zugehörigkeit und des sozialen Rückhalts. Zudem haben Unterstützungsleistungen auch eine Bewertungsfunktion: Sie erlauben eine Orientierung über die eigene soziale Verortung und ermöglichen eine (Selbst-)Bestätigung, die eigenen Fähigkeiten und Bedürfnisse bewältigungsfördernd einzuschätzen und gleichzeitig die eigenen Möglichkeiten von Kontrolle und Resilienz zu stärken.
Je nachdem, welche Bedürfnisse der sozialen Unterstützung zu Grunde liegen, kann diese unterschiedlich sein. So können bei der Verarbeitung kritischer Lebensereignisse emotionale Unterstützung, soziale Rückhalte sowie informationelle Unterstützung besonders wirksam sein.
Soziale Unterstützung und Gesundheit
Die Zusammenhänge von sozialer Unterstützung mit verschiedenen Gesundheitsindikatoren wurden in einer ganzen Reihe von Studien untersucht (Determinanten der Gesundheit). Beispielsweise zeigte eine frühe längsschnittliche (mittlerweile klassische) Studie von Berkman et al., dass die Überlebenswahrscheinlichkeit älterer Patientinnen und Patienten nach erlittenem Myokardinfarkt dann größer war, wenn sie über mindestens zwei Personen in ihrem Umfeld verfügten, die sie emotional unterstützten (Berkman et al. 1992). Seit diesem Befund gab es weitere Studien, die zu vergleichbaren Ergebnissen gekommen sind (Hemingway & Marmot 1999; Smith & Ruiz 2002; Szreter & Woolcock 2004; Almedom 2005; Orth-Gomer 2009).
Auch für Deutschland konnten Untersuchungen des Robert Koch-Instituts zeigen, dass diejenigen ihre subjektive Gesundheit besser einschätzten, die über eine als ausreichend wahrgenommene Unterstützung verfügten (RKI 2010). In Bezug auf die Sterbewahrscheinlichkeit konnten Holt-Lunstad et al. in einer umfangreichen Meta-Analyse zeigen, dass neben anderen Aspekten sozialer Beziehungen auch die subjektiv als positiv wahrgenommene soziale Unterstützung die Mortalität senkt. Darüber hinaus weisen die Autorinnen und Autoren in ihrem Fazit darauf hin, dass möglicherweise gerade das Fehlen von sozialer Unterstützung bzw. soziale Isolation sich besonders negativ auf die Gesundheit auswirken können, da diese wiederum das Auftreten bekannter Risikofaktoren wie etwa Rauchen, Stress oder etwa Adipositas begünstigen (Holt-Lunstad et al. 2010).
Erklärungsansätze
Wie können diese Zusammenhänge erklärt werden? Grundsätzlich können zwei Erklärungsansätze unterschieden werden. Zum einen ist es wahrscheinlich, dass soziale Unterstützung insbesondere in Stresssituationen und in Zeiten besonderer Herausforderungen (siehe kritische Lebensereignisse weiter oben) die gesundheitlich negativen Folgen dieser Situationen und Ereignisse abfedern bzw. „puffern“ können. Daher spricht man in diesem Zusammenhang vom sogenannten Puffer-Effekt sozialer Unterstützung, der insbesondere in Zeiten besonderer Belastungen wirksam wird. In Situationen, in denen Individuen Hilfe und Unterstützung benötigen, diese aber nicht bekommen, sind diesem Erklärungsansatz zufolge gesundheitlich negative Folgen besonders wahrscheinlich, während diejenigen, die über Unterstützungsressourcen aus ihrem sozialen Umfeld verfügen, die gesundheitlichen Stressoren besser abfedern („puffern“) können. Demzufolge haben soziale Beziehungen eine protektive Funktion in Zeiten erhöhter Stressexposition. Gerade im Zusammenhang mit dem plötzlichen Auftreten kritischer Ereignisse, etwa dem Verlust des Partners oder dem Tod einer nahestehenden Person, konnten stressreduzierende Auswirkungen sozialer Beziehungen beobachtet werden (Rosengren et al. 1993).
Zum anderen ist auch denkbar, dass soziale Unterstützung einen generellen positiven Effekt auf das Wohlbefinden und die Gesundheit hat. Diesem sogenannten Haupteffekt-Modell zufolge wird davon ausgegangen, dass dauerhafte soziale Beziehungen langfristig einen positiven Effekt auf die Gesundheit haben, unabhängig von (akuten) gesundheitlichen Stressoren: Stabile soziale Beziehungen und soziale Interaktionen wirken sich demnach positiv auf die Persönlichkeitsentwicklung, das Selbstvertrauen sowie die generelle Entwicklung von Bewältigungsstrategien (coping) aus. Mit einem höheren Grad an sozialer Interaktion und mit stärker ausgeprägten sozialen Beziehungen gehen bessere Zugangschancen zu materiellen Ressourcen im sozialen Umfeld einher, die wiederum positiv mit Gesundheitsoutcomes assoziiert sind (Stansfeld 2006; Berkman & Krishna 2014).
Auch soziales Engagement kann langfristig positive Gesundheitsoutcomes zur Folge haben. Es konnte gezeigt werden, dass ehrenamtliches Engagement, die Übernahme verschiedener sozialer Funktionen und Rollen generell sinnstiftend sind und zur Identitätsbildung der Einzelnen beitragen, da hierdurch die Einbettung in gesellschaftliche Zusammenhänge und dadurch die eigene Bedeutung (sense of coherence) innerhalb dieser sozialen Netze den Individuen gespiegelt wird (Antonovsky 1997). Unter anderem ist dies mit besserer psychischer Gesundheit und höherer psychischer Funktionsfähigkeit im höheren Lebensalter assoziiert (Glymour et al. 2008).
Innerhalb sozialer Beziehungen werden Werte und Normen transportiert, die sich beispielsweise auf gesundheitsrelevante Verhaltensweisen wie etwa das Rauchen und die Ernährung auswirken (Christakis & Fowler 2008). Studien im Jugendalter konnten die Einflüsse der peer group hervorheben (Moody et al. 2010; Valente et al. 2013). Einer Studie von Kouvonen et al. zufolge entwickelten Personen mit ausreichend sozialer Unterstützung sowohl einen höheren Grad an physischer Aktivität als auch einen aktiveren Lebensstil (Kouvonen et al. 2011). So kann soziale Unterstützung die Chancen erhöhen, dass körperliche Aktivität über einen längeren Zeitraum aufrechterhalten bleibt.
Demgegenüber deutet eine Studie von Strine et al. an, dass geringere emotionale Unterstützung mit höheren gesundheitlichen Risiken (Übergewicht, Rauchen etc.) wie auch mit einem schlechteren allgemeinen Gesundheitszustand (subjektive Gesundheit, depressive Symptome) assoziiert ist (Strine et al. 2008). Ein solcher Zusammenhang lässt sich bis ins hohe Lebensalter nachweisen (Nummela et al. 2011). Fehlende soziale Unterstützung (und insbesondere deren individuelle Wahrnehmung) ist deutlich mit höherer Stressbelastung und entsprechend höheren gesundheitlichen Risiken, die sich daraus ergeben, assoziiert (Stress und Stressbewältigung).
Ressourcen von Gruppen und Gemeinschaften
Soziale Unterstützung ist nicht unabhängig von den individuellen und sozialen Ressourcen von Gruppen und Gemeinschaften zu betrachten. Das Pfad-Modell (siehe Abbildung 1) von Berkman & Krishna (2014) verdeutlicht die Zusammenhänge auf verschiedenen Ebenen. Individuelle Ressourcen sowie soziale Kontakte sind eingebettet in soziale Netzwerke, die wiederum in einer größeren (Makro-)Struktur verortet sind, da sie von gelebten Normen und Werten und den ökonomischen und sozialen Ressourcen abhängen und durch Gesetze oder politische Entscheidungen beeinflusst werden können. Die unterschiedlichen Ebenen sind miteinander verbunden und verdeutlichen, wie die Zusammenhänge mit individueller Gesundheit verstanden und erklärt werden können. Damit weist das Modell auch auf den Zusammenhang zwischen sozialen Beziehungen und sozialer Ungleichheit hin (Soziale Ungleichheit und Gesundheit/Krankheit).
Soziale Unterstützung und soziales Kapital können gerade dort entstehen, wo bereits Ressourcen in einem gewissen Umfang vorhanden sind; in der Unterstützungsforschung konnte wiederholt dargestellt werden, dass geringer sozioökonomischer Status auch mit einem höheren Risiko für geringere soziale Unterstützung assoziiert ist. Diese strukturellen Zusammenhänge sollten bei der Untersuchung von sozialen Beziehungen stets mitgedacht werden; auch dies wird durch das Modell von Berkman & Krishna verdeutlicht (siehe auch Vonneilich & Knesebeck 2020).
Gleichzeitig ist in dem Modell auch die Möglichkeit negativer Aspekte bestimmter psychosozialer Mechanismen bedacht, etwa soziale Isolation oder das Ausbleiben sozialer Reziprozität (negative Aspekte sozialer Unterstützung). Auch ein länger erfahrenes Ungleichgewicht zwischen Geben und Nehmen innerhalb von sozialen Beziehungen kann gesundheitliche Auswirkungen haben. Ausbleibende Reziprozität innerhalb sozialer Beziehungen, sowohl innerhalb von Partnerschaften und in der Beziehung zu Kindern als auch allgemeine und eher unspezifische Erfahrungen mit mangelnder Reziprozität, sind mit schlechter subjektiver Gesundheit und einem höheren Risiko für depressive Symptome assoziiert (Knesebeck et al. 2009). Zu ähnlichen Ergebnisse kamen weitere Studien zur mangelnden Reziprozität (Knesebeck & Siegrist 2003; Chandola, Marmot & Siegrist 2007).
Zukünftige Forschung zum Zusammenhang zwischen sozialen Beziehungen und Gesundheit sollten belastenden Aspekten mehr Aufmerksamkeit widmen. Weitere ambivalente Auswirkungen von sozialen Beziehungen auf die Gesundheit sind denkbar, etwa bei dauerhaften Belastungen, Konflikten und problematischen Beziehungen.
Bedeutung für die Praxis
Auf individueller Ebene können Informationen seitens der Patientinnen und Patienten zu sozialer Unterstützung und sozialer Einbettung medizinische Entscheidungsfindungen führen und ggf. therapeutische Maßnahmen unterstützen und stärken, beispielsweise durch die Einbeziehung von Unterstützungsangeboten. Auch das Hinzuziehen von Angehörigen sowie weiterer Personen im engeren sozialen Umfeld ist gerade für chronisch Kranke eine wichtige Ressource.
Aus gesellschaftlicher Perspektive verweist soziale Unterstützung stets auf den gesellschaftlichen und sozialen Raum, der die Entwicklung von unterstützenden Beziehungen und Interaktion ermöglicht (Soziales Kapital). Daher kann es auch zur langfristig positiven Entwicklung der Gesundheit in Quartieren, Stadtteilen oder Gemeinschaften beitragen – wenn Möglichkeiten zur sozialen Interaktion und Begegnung und zur Förderung lokaler Netzwerke geschaffen werden. Insbesondere der präventive Charakter einer so entstehenden „sozialen Einbettung“ darf nicht unterschätzt werden.
Ein höheres Maß an sozialer Interaktion trägt zu gesundheitsförderlichem Verhalten und der Etablierung entsprechender Normen bei und erleichtert innerhalb von gut organisierten Communities und Nachbarschaften den Zugang zu gesundheitsrelevantem Wissen (Berkman & Krishna 2014). Ungünstige Wohn- und Lebensbedingungen, wovon überproportional häufig sozioökonomisch schlechtgestellte Gruppen betroffen sind, bieten im Vergleich eher weniger Raum für soziale Interaktion und sind darüber hinaus häufiger mit höheren Risiken für die Gesundheit assoziiert (Mujahid et al. 2008; Dragano et al. 2009).
Konkrete Strategien für sozialräumliche Interventionen gibt es schon länger, etwa in der Selbsthilfeförderung (Selbsthilfe, Selbsthilfegruppen und Selbsthilfeförderung), der Gesundheitsbezogenen Gemeinwesenarbeit, der Quartiers- und der Organisationsentwicklung als Methode der Gesundheitsförderung. Ihnen allen ist gemein, dass sie Anlaufstellen, Hilfsmöglichkeiten und Unterstützung in das alltägliche Lebensumfeld integrieren und so neue Verbindungen und Kontaktmöglichkeiten schaffen, auf deren Basis soziale Unterstützung in der Gesundheitsförderung und anderen Lebensbereichen wirken kann. Auch in der Entwicklung von Quartieren und Stadtteilen werden öffentliche Interaktionsräume wieder stärker mitgedacht, um die Bildung von sozialen Netzwerken zu fördern und Interaktionen zu schaffen, die zu einer Stärkung individueller sozialer Beziehungen führen.
Literatur:
Almedom, A. M. (2005). Social capital and mental health: an interdisciplinary review of primary evidence. Social Science & Medicine 61(5): 943−964.
Antonovsky, A. (1997). Salutogenese − Zur Entmystifizierung von Gesundheit. Tübingen: DGVT Verlag.
Barrera, M. (1986). Distinctions between social support concepts, measures, and models. American Journal of Community Psychology 14(4): 413−445.
Berkman, L. F. & Krishna, A. (2014). Social network epidemiology. In L. F. Nerkman, I. Kawachi & M. M. Glymour (Eds.). Social Epidemiology, S. 234−290. New York: Oxford University Press.
Berkman, L. F., Leo-Summers, L. et al. (1992). Emotional support and survival after myocardial infarction. A prospective, population-based study of the elderly. Annals of Internal Medicine 117(12): 1003−1009.
Chandola, T., Marmot, M. & Siegrist, J. (2007). Failed reciprocity in close social relationships and health: findings from the Whitehall II-Study. Journal of Psychosomatic Research 63(4): 403−411.
Christakis, N. A., Fowler, J. H. (2008). The collective dynamics of smoking in a large social network. New England Journal of Medicine 358(21): 2249−2258.
Dragano, N. et al. (2009). Subclinical coronary atherosclerosis and neighbourhood deprivation in an urban region. European Journal of Epidemiology 24(1): 25−35.
Glymour, M. M. et al. (2008). Social ties and cognitive recovery after stroke: does social integration promote cognitive resilience? Neuroepidemiology 31(1): 10−20.
Hemingway, H. & Marmot, M. (1999). Evidence based cardiology: psychosocial factors in the aetiology and prognosis of coronary heart disease. Systematic review of prospective cohort studies. British Medical Journal 318(7196): 1460−1467.
Holt-Lunstad, J., Smith, T. B. et al. (2010). Social relationships and mortality risk: a meta-analytic review. PLoS Medicine 7(7): e1000316.
House, J. S. et al. (1988). Social relationships and health. Science 241(4865): 540−545.
Knesebeck, O. v. d., Siegrist, J. (2003). Reported non-reciprocity of social exchange and depressive symptoms: extending the model of effort-reward imbalance beyond work. Journal of Psychosomatic Research 55(3): 209−214.
Knesebeck, O. v. d., Dragano, N. et al. (2009). Psychosoziale Belastungen in sozialen Beziehungen und gesundheitliche Einschränkungen. Psychotherapie, Psychosomatik und Medizinische Psychologie (PPmP) 59(5): 186−193.
Kouvonen, A. et al. (2011). Social support and the likelihood of maintaining and improving levels of physical activity: the Whitehall II Study. European Journal of Public Health 22(4): 514−518.
Lakey, B. & Cohen, S. (2000): Social support theory and measurement. In S. Cohen, L. G. Underwood & B. H. Gottlieb (Eds.). Social support measurement and intervention: A guide for health and social scientists, S. 29−52. New York: Oxford University Press.
Moody, J. et al. (2010). Mining the network: peers and adolescent health. Journal of Adolescent Health 47(4): 324−326.
Mujahid, M. S. et al. (2008). Neighborhood characteristics and hypertension. Epidemiology 19(4): 590−598.
Nummela, O. et al. (2011). The effect of loneliness and change in loneliness on self-rated health (SRH): a longitudinal study among aging people. Archives of Gerontology and Geriatry 53(2): 163−167.
Orth-Gomer, K. (2009). Are social relations less health protective in women than in men? Social relations, gender, and cardiovascular health. Journal of Social and Personal Relationships 26(1): 63−71.
RKI − Robert Koch-Institut (2010). Daten und Fakten: Ergebnisse der Studie Gesundheit in Deutschland aktuell 2010. Berlin: RKI.
Rosengren, A. et al. (1993). Stressful life events, social support, and mortality in men born in 1933. British Medical Journal 307(6912): 1102−1105.
Smith, T. W. & Ruiz, J. M. (2002). Psychosocial influences on the development and course of coronary heart disease: current status and implications for research and practice. Journal of Consulting and Clinical Psychology 70(3): 548−568.
Stansfeld, S. (2006). Social support and social cohesion. In M. Marmot & R. G. Wilkinson (Eds.). Social determinants of health, S. 148−171.New York: Oxford University Press.
Strine, T. W. et al. (2008). Health-related quality of life and health behaviors by social and emotional support - their relevance to psychiatry and medicine. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology 43(2): 151−159.
Szreter, S. & Woolcock, M. (2004). Health by association? Social capital, social theory, and the political economy of public health. International Journal of Epidemiology 33(4): 650−667.
Turner, R. J. & Marino, F. (1994). Social Support and Social Structure: A Descriptive Epidemiology. Journal of Health and Social Behaviour 35(3): 193−212.
Uchino, B. N. (2009). What a Lifespan Approach Might Tell Us about Why Distinct Measures of Social Support have Differential Links to Physical Health. Journal of Social and Personal Relationships 26(1): 53−62.
Valente, T. W. et al. (2013). A comparison of peer influence measures as predictors of smoking among predominantely Hispanic/Latino high school adolescents. Journal of Adolescent Health 52(3):358−364.
Vonneilich, N. & Knesebeck, O. v. d. (2020). Gesundheitliche Ungleichheit und soziale Beziehungen. In P. Kriwy & M. Jungbauer-Gans (Hrsg.). Handbuch Gesundheitssoziologie, S. 253−273. Springer, Berlin.
Wills, T. A. & Shinar, O. (2000). Measuring Perceived and Received Social Support. In S. Cohen, L. G. Underwood et a. (Eds). Social support measurement and intervention - a guide for health and social scientists, S., 86−135. New York: Oxford University Press.
Verweise:
Determinanten der Gesundheit, Organisationsentwicklung als Methode der Gesundheitsförderung, Selbsthilfe, Selbsthilfegruppen und Selbsthilfeförderung, Soziale Netzwerke und Netzwerkförderung, Soziale Ungleichheit und Gesundheit/Krankheit, Soziales Kapital, Stress und Stressbewältigung

 Suche
Suche